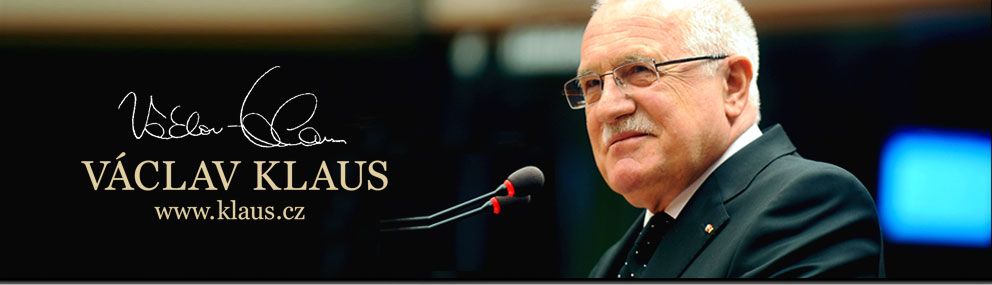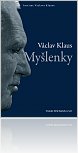Nejnovější
Nejčtenější
Hlavní strana » Deutsche Seiten » Ich hätte durchhalten sollen
Ich hätte durchhalten sollen
Deutsche Seiten, 12. 5. 2014
 Der ehemalige tschechische Staatspräsident Václav Klaus über den Ukraine-Konflikt, sein Verhältnis zu Wladimir Putin, die Krise der EU und die Masseneinwanderungsinitiative.
Der ehemalige tschechische Staatspräsident Václav Klaus über den Ukraine-Konflikt, sein Verhältnis zu Wladimir Putin, die Krise der EU und die Masseneinwanderungsinitiative.
Für die EU ist Václav Klaus ein unbequemer Politiker. Als der damalige tschechische Staatspräsident (2003–2013) im Jahr 2009 den Vertrag von Lissabon unterschreiben sollte, der die Integration der Europäischen Union vorantreibt, verweigerte Klaus lange seine Unterschrift. Der 73-Jährige soll auch schon nach zwei Minuten Interviews beendet haben, in denen er als Euro-Skeptiker bezeichnet wurde. Richtig muss es, so will er es, «Euro-Realist» heissen.
Als uns Klaus am letzten Freitag auf der Terrasse des «Dolder Grand» zum Interview empfängt, wird rasch klar: Hier spricht eine zeitgeschichtliche Autorität. Unterbrechungen seiner langen Ausführungen schätzt er nicht, und er toleriert sie nur ausnahmsweise.
Gelegentlich beweist der messerscharf analysierende Intellektuelle und von seiner reichen Biografie getragene politische Denker frischen Schalk. Ironisch spielt er mit seinem nicht ganz perfekten Deutsch.
Als der Fotograf ihn zum Schluss des Gesprächs auffordert, für ein weiteres Bild auf ein für die «Dolder»-Gäste zur Verfügung gestelltes Elektrovelo zu sitzen, zögert Klaus kurz und kurvt dann aber mit sichtlichem Vergnügen hoch über Zürich zwischen den parkierten Limousinen und Sportwagen herum.
In der Ukraine sind teilweise bürgerkriegsähnliche Zustände mit etlichen Todesopfern zu beklagen. Welche weitere Wendung wird der Konflikt Ihrer Einschätzung nach nehmen?
Über Szenarien kann man nur sprechen, wenn man zuvor die Ursachen analysiert hat. Und diesbezüglich bin ich enttäuscht über die inakzeptable Trivialisierung der Debatte in Europa. Ich sehe die Ursache der gegenwärtigen Krise nicht in einer authentischen Revolution. Die Ukraine wurde von aussen angestachelt.
Worauf stützen Sie diese Aussage?
Politiker und Aktivisten aus Europa und aus den USA haben die Proteste aktiv unterstützt. Nicht nur philosophisch und politisch, sondern auch finanziell. Ich befürchte zudem, dass einige ausländische Gruppierungen auch Waffen geliefert haben, und das ist für mich inakzeptabel. Ich bin kein Verteidiger Russlands, aber es ist klar, dass Russland die Situation auf dem Maidan-Platz nicht organisiert hat, und das war der Ausgangspunkt des Konflikts: Proteste, die mindestens teilweise nicht spontan waren.
Sie selbst haben als junger Mann den Sturz des kommunistischen Regimes in der damaligen Tschechoslowakei miterlebt. Haben Sie kein Verständnis für die jungen, idealistischen Leute, die sich nach Westen orientieren wollen und mit dem Regime Janukowitschs unzufrieden sind?
Das Bild der jungen Idealisten auf der einen Seite und der ex-stalinistischen russischen Politiker auf der anderen Seite gehört für mich zur Trivialisierung der Debatte. Es hat mit der Realität wenig zu tun. Ich stand dem Janukowitsch-Regime immer sehr kritisch gegenüber und möchte das auch betonen. Janukowitsch hat mich in meiner Eigenschaft als Präsident der Tschechischen Republik mehrmals in die Ukraine eingeladen, und ich habe die Einladung immer ausgeschlagen, weil ich ihn nicht durch meine Anwesenheit legitimieren wollte. Da fällt mir ein: Es gibt jährlich ein sehr wichtiges Treffen der achtzehn Präsidenten aus mittel-, ost- und südeuropäischen Ländern, dessen Vorsitz rotiert. Dabei sind auch Österreich, Deutschland und Italien. Es ist also wirklich eine wichtige Veranstaltung, die ich einmal selbst in Tschechien organisiert habe. Vor zwei Jahren sollte das Treffen unter der Organisation von Janukowitsch in Kiew stattfinden. Etliche Teilnehmer zögerten, und am Schluss war ich mehr oder weniger das Zünglein an der Waage. Damals sass Julia Timoschenko im Gefängnis in Kiew. Ich habe Janukowitsch in einem Brief dargelegt, dass für mich allenfalls eine Teilnahme an einem Ort ausserhalb der Hauptstadt denkbar ist, aber nicht ausgerechnet in derselben Stadt, in der Timoschenko inhaftiert ist. Darauf ging Janukowitsch nicht ein, und so musste er das Treffen eine Woche vor der geplanten Austragung absagen. Daran sehen Sie: Ich bin wahrlich kein Parteigänger Janukowitschs.
Woher kommt Ihres Erachtens die Verengung der Ukraine-Diskussion auf Stereotype?
Viele westliche Politiker haben Angst, dass Russland wieder zu Stärke und Selbstbewusstsein findet. Das wollen sie bremsen. Darin sehe ich die langfristige Strategie. Die zweite Motivation ist sicher die Vermischung der Kritik am heutigen Russland mit der Kritik an der ehemaligen Sowjetunion unter Stalin, Breschnjew und so weiter.
Putins KGB-Karriere ruft solche Gedanken auf den Plan.
Putin vereint bestimmt viele Dimensionen in sich, die nichts mit dem KGB und der Sowjetunion zu tun haben.
Wie schätzen Sie Putin ein?
Während meiner Amtszeit als Staatspräsident war mein russischer Amtskollege Dmitri Medwedew. Er gehört einer jüngeren Generation an, die beim Zusammenbruch des Kommunismus noch an der Universität war. Er steht mir also persönlich und menschlich näher. Mit Putin bin ich aber auch einige Male zusammengetroffen. Man kann mit ihm sehr gut sprechen. Er ist pragmatisch, sehr sachlich und immer perfekt vorbereitet, allerdings weniger persönlich als Medwedew. Eine bleibende Erinnerung ist, wie ich vor eineinhalb Jahren für eine inoffizielle Rede in Moskau war. Da liess mich Putin anfragen, ob ich am Abend um sechs oder halb sieben nicht bei ihm zum Kaffee vorbeikommen möchte.
So spät noch zum Kaffee?
Vermutlich haben wir Tee getrunken . . . Auf jeden Fall kam ich mit leeren Händen zu Putin in der Absicht, guten Abend zu sagen und ein paar Punkte anzusprechen. Zu meiner Überraschung hatte der bestimmt genügend beschäftigte Putin ein achtzigseitiges Dokument vor sich, gespickt mit handschriftlichen Notizen. Er diskutierte Details, auf die ich alles andere als vorbereitet war. Also: Putin ist fleissig, arbeitet viel und ist ein pragmatischer, kein apriorischer Politiker. Das respektiere ich.
Trotzdem werden Russland und Putin dämonisiert.
Vor ein paar Tagen habe ich mit einem alten Freund gesprochen, der seit dem Einmarsch der sowjetischen Truppen zur Niederschlagung des Prager Frühlings im Jahr 1968 in Deutschland lebt. Er ist ein Paradebeispiel für die Trivialisierung, die ich erwähnt habe. Auf die Frage, warum er so argumentiere, hat er geantwortet, er sei seit 1968 antirussisch. Ich habe nachgefragt: antirussisch oder antikommunistisch, antisowjetisch? Doch er bekräftigte: «Ich bin so antirussisch, dass ich sogar die klassische russische Literatur aus der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts nicht lesen kann.» Stellen Sie sich diese Irrationalität vor! Wer wegen Ereignissen im Jahr 1968 Dostojewski und Tschechow nicht liest, der offenbart eine Verwirrung des Denkens, die ich nicht unterstützen kann.
Auch Sie mussten den Kommunismus fünfzig Jahre lang erdulden.
Ja, und zwar als Feind der Machthaber. Nach dem Einmarsch der sowjetischen Truppen und des Warschauer Pakts wurde ich als junger Ökonom von 28 Jahren, also noch bevor meine Karriere richtig beginnen konnte, aus der Akademie der Wissenschaften entfernt, aufs Abstellgleis geschoben und isoliert. Zwanzig Jahre lang konnte ich nicht mehr in den Westen fahren. Ich bin der Letzte, der den Kommunismus verteidigt.
Obwohl Russland in Ihrer Biografie eher eine negative Rolle spielt: Wo sehen Sie kulturell Verbindendes zwischen dem Westen und Russland?
Dieser tiefen philosophischen Debatte kann man nicht in zwei Sätzen gerecht werden, wenn man sie nicht verflachen will. Nur so viel: Bestimmt unterscheiden wir uns in Zentraleuropa in mancher Hinsicht von den Russen. Aber im Prinzip, also kulturell und zivilisatorisch, empfinde ich zwischen Zürich und Prag auf der einen Seite und Russland auf der anderen Seite geringere Unterschiede, als wenn ich Russland mit China, Indien, Indonesien, Afrika oder Lateinamerika vergleiche. Dort sind die kulturellen Unterschiede tiefer. Auf der Weltkarte ist Russland auf unserer Seite.
Was muss der Westen jetzt tun, wenn ihm am Wohl der ukrainischen Bevölkerung gelegen ist?
Ich habe keinen Vorschlag. Da ich nicht für die heutige Situation verantwortlich bin, weiss ich auch nicht, ob es an mir ist, Lösungen zu suchen. Leider befürchte ich, dass es keine schnelle Lösung geben kann. Zuerst einmal müssen sofort die Provokationen, egal von welcher Seite, aufhören. Die grösste Gefahr ist, dass es von irgendwoher eine grössere Provokation geben kann. Wie ich das Genfer Treffen verstanden habe, ging es darum, genau dem entgegenzuwirken. Ich hoffe, dass das Bestand hat. Wie es weitergehen wird, weiss ich nicht.
Manche setzen grosse Erwartungen in die Wahlen in der Ukraine.
Zu diesen gehöre ich nicht. Wahlen können im Moment nur die Mehrheitsverhältnisse zwischen der westukrainischen und ostukrainischen Bevölkerungsgruppe abbilden. Das heisst aber nicht, dass der jeweils andere Teil das Ergebnis akzeptiert. Die von den Amerikanern und ihrem Vizepräsidenten Biden geäusserte Hoffnung ist gut gemeint, aber irrelevant. Um zu sehen, wozu Wahlen in einem gespaltenen Land führen, muss man nur nach Ägypten sehen. Sie lösen das Problem der Spaltung nicht.
Sollte man die Ukraine teilen, analog zur Auftrennung von Tschechien und der Slowakei nach dem Fall des Eisernen Vorhangs?
Eher gegen meinen Willen musste ich als Ministerpräsident die Trennung von der Slowakei organisieren. Ich weiss also, wie schwierig so ein Prozess ist. Ich muss aber auch sagen, dass eine solche Spaltung möglich ist, wenn sie gut organisiert und in einem freundschaftlichen Geist geschieht. Wichtig sind zudem ein rasches Vorgehen und eine gewisse Grosszügigkeit. Man kann sich nicht mit jedem Detail aufhalten, sondern man muss mit einem gesunden Blick für das Grosse und Ganze ans Werk: Man trennt beispielsweise im Verhältnis zwei zu eins, ohne sich in Details zu verheddern. Für Tschechien und die Slowakei war die Trennung letztlich sehr erfolgreich, positiv für beide Länder. Ob das in der Ukraine auch möglich wäre? Ich weiss es nicht.
Wie tief ist die Spaltung der Ukraine nach Ihrem Dafürhalten?
Ich war nur einmal drei Tage dort. Kiew ist europäisch. Odessa ist russisch, jüdisch. Lemberg (Lwiw) ist wie eine mitteleuropäische Stadt. Vor ein paar Tagen habe ich mit einer ukrainischen Studentin in Prag gesprochen, die aus dem Gebiet der Westukraine stammt, das vor achtzig Jahren noch zur Tschechoslowakei gehörte. Diese kulturelle Herkunft und die Erinnerung der Eltern und Grosseltern waren für sie die Motivation für ein Studium in Prag. Sie durchlebt derzeit grosse Angst, weil ihre beiden Brüder in die Armee eingezogen wurden. Und sie erzählte mir, dass sie im letzten Sommer zum ersten Mal in ihrem Leben auf der Krim war und diesen Aufenthalt sehr genossen hat, da die Westukraine weder grosse Seen noch Meeranstoss hat. «Es war sehr schön», sagte sie zu mir, «aber ich musste überrascht feststellen, dass man dort meine ukrainische Sprache nicht verstanden hat.» Man habe sie sogar für eine Moldawierin gehalten. Die Anekdote dieser jungen, aufgeweckten Uni-Studentin fand ich doch vielsagend.
Werden in der Auseinandersetzung auch die Defizite der politischen Führung in der EU deutlich?
Im Prinzip ja. Die politischen Führer Europas haben die Situation in der Ukraine unterschätzt und sich nicht bemüht, das Land zu verstehen. Die Ukraine auf die eine oder andere Seite zu zwingen, das war ein Fehler.
Herr Klaus, sprechen wir über Europa. In den Medien werden Sie gewöhnlich als EU-Skeptiker bezeichnet…
Das sehe ich anders. Für mich gibt es EU-Realisten und EU-Naive.
Wo sehen Sie die grössten Fehler in der Konstruktion der EU?
In der griechischen und der römischen Antike hing an jeder Haustüre eine Skulptur des Gottes Janus. Dieser hat einen Kopf, aber zwei Gesichter. Die Integration der EU ist ein janusköpfiger Prozess. Das sympathische Gesicht besteht aus der Liberalisierung und der Beseitigung von Barrikaden, wie sie nach dem Zweiten Weltkrieg dringend nötig waren. Das zweite Gesicht sieht ganz anders aus. Hier geht es nicht mehr um die Einigung, sondern um die Unifizierung, Harmonisierung, Standardisierung und die Zentralisierung. Auch dieses Gesicht hatte die europäische Einigung von allem Anfang an. Das heisst, die EU leidet an ihren Fehlern seit der Geburt. Sieht man sich die jeweils vorherrschende Tendenz an, dann überwog in der ersten Etappe die positive Seite.
Also Freihandel, Abbau von Zöllen, Beseitigung von Handelsschranken.
Ja. Für einen liberalen Ökonomen wie mich ist das alles hundertprozentig positiv. In der ersten Etappe des europäischen Integrationsprozesses war die Kosten-Nutzen Analyse mit Sicherheit im grünen Bereich. Bei der zweiten Etappe, die ich dann mit dem Namen Jacques Delors, den Verträgen von Maastricht und Lissabon und dem verunglückten Verfassungsentwurf von Giscard d’Estaing verbinde, dominiert die schlechte Seite.
Als tschechischer Staatspräsident haben Sie widerwillig und als letzter den Lissabon-Vertrag unterschrieben. Mit welchem Gefühl haben Sie die Unterschrift geleistet?
Ich hatte nicht genug Stärke, als letzter Staatspräsident noch länger zu widerstehen. Aus heutiger Sicht hätte ich das noch ein paar Monate durchhalten sollen. Leider gab es in der ersten Etage der europäischen Politik keine Verbündeten für meine Position, nur einige vereinzelte in der zweiten Etage.
Was beunruhigt Sie derzeit in der EU am meisten?
Die immer schlechteren Wirtschaftsdaten, der abnehmende Respekt in der restlichen Welt vor Europa, die beschleunigte Vertiefung demokratischer Defizite und die Steigerung der Frustration in grossen Teilen der europäischen Bevölkerung erlangen politisch kaum Aufmerksamkeit. Das macht mich nervös. Europa ist eine postdemokratische und postpolitische Einrichtung. Das sieht man auch am Umgang der EU mit der Schweizer Volksabstimmung zur Einwanderung. Die EU-Spitzenpolitiker wollen uns ein Kontinentaldenken aufzwingen. Sie wollen den Nationalstaat unterdrücken und staatliche Grenzen auflösen. Um den Zusammenhalt der heutigen Nationen zu schwächen, propagieren sie eine massive und uneingeschränkte Migration.
Die EU erachtet die Personenfreizügigkeit als eine ihrer Grundfreiheiten – das müsste Ihnen als Liberaler ja sympathisch sein.
Man muss unterscheiden zwischen den «Freiheiten», die uns die EU verspricht, und der Freiheit als politischem und kulturellem Wert, für den ich als Liberaler kämpfe. Die Migrationsbewegungen über die Grenzen souveräner Länder hinweg, die in den letzten Jahrzehnten radikal verstärkt wurden, untergraben systematisch den Zusammenhalt und die Regierbarkeit von Ländern. Die Schwächung der einzelnen Staaten könnte sehr leicht auf eine antiliberale Entwicklung hinauslaufen, weil sie nämlich den europäischen Super-Staat stärkt, zu dem die EU sich entwickelt. Doch die EU ist weniger demokratisch als jeder einzelne ihrer Mitgliedsstaaten. Ich habe nie das Einwandern in irgendein Land als mein Recht betrachtet. Dass die Schweizer die Kontrolle über das Ausmass der Einwanderung behalten wollen, ist verständlich. Ich habe den Volksentscheid auch nicht als ein absolutes Nein zur Migration verstanden, sondern als eine Mitteilung: «Lasst uns die Einwanderung vorsichtiger und langsamer gestalten.»
Es scheint, als ob Parteien und Bewegungen, die den heutigen Tendenzen in Brüssel ähnlich kritisch gegenüberstehen wie Sie, bei den Wahlen fürs Europaparlament im Mai mit einem Erfolg rechnen können.
Die Wahlen werden, wenn überhaupt, einen sehr geringen Einfluss haben. An den eigentlichen Mehrheitsverhältnissen in der EU werden sie nichts ändern. Zudem ist es sehr schwierig, die unzähligen Gruppen zusammenzubringen, die man als EU-Skeptiker bezeichnet.
Wäre es denn wünschenswert, Parteien wie die Alternative für Deutschland in Deutschland mit dem Front national in Frankreich und der United Kingdom Independence Party in Grossbritannien zusammenzubringen?
Ich brauche keine paneuropäischen Parteien. Wir haben in Europa kein Volk, keinen Demos im Sinne der politologischen Literatur.
Sehen Sie sich als Europäer?
Die europäische ist bestimmt eine meiner Identitäten, aber ich trage viel stärkere in mir. Ich bin Prager, Tscheche und Mitteleuropäer. Mit anderen Mitteleuropäern habe ich viel mehr gemeinsam als mit den Portugiesen, Finnen oder Zyprioten. Die europäische Identität in mir ist nicht sehr stark. Den Satz «Ich bin ein Europäer» benutze ich nur in Afrika oder Südasien. Und einmal verwendete ich ihn, als ich in den Rocky Mountains zum Skifahren war. Mein junger Skilehrer war ganz unwissend, was die europäische Geografie betrifft, und fragte mich, wo ich herkomme. Ich verstand, dass es keinen Wert hatte, dem jungen Mann zu sagen, dass ich aus der Tschechischen Republik stamme. Also habe ich gesagt: «Aus Europa.»
Gibt es derzeit Politiker in Europa, an die Sie Hoffnungen knüpfen?
Ich möchte keine einzelnen Namen herauspicken, weil das Problem Europas nicht zuerst mit einzelnen Namen zu tun hat. Ich bin ganz sicher, dass ganz neue Umstände und Probleme auch neue Politiker an die Oberfläche bringen. Die Frage ist: Wodurch kann eine solche neue Atmosphäre entstehen? Das kann ein Politiker nicht schaffen, sei er noch so charismatisch. Was sich ändern muss, sind das Denken und das Benehmen. Und das geschieht nur im Falle einer dringenden Notwendigkeit. Dafür ist Europa noch zu reich.
Florian Schwab und Marc Wetli (Bild), Die Weltwoche, Nummer 18, 30. April 2014.
- hlavní stránka
- životopis
- tisková sdělení
- fotogalerie
- Články a eseje
- Ekonomické texty
- Projevy a vystoupení
- Rozhovory
- Dokumenty
- Co Klaus neřekl
- Excerpta z četby
- Jinýma očima
- Komentáře IVK
- zajímavé odkazy
- English Pages
- Deutsche Seiten
- Pagine Italiane
- Pages Françaises
- Русский Сайт
- Polskie Strony
- kalendář
- knihy
- RSS
Copyright © 2010, Václav Klaus. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru.