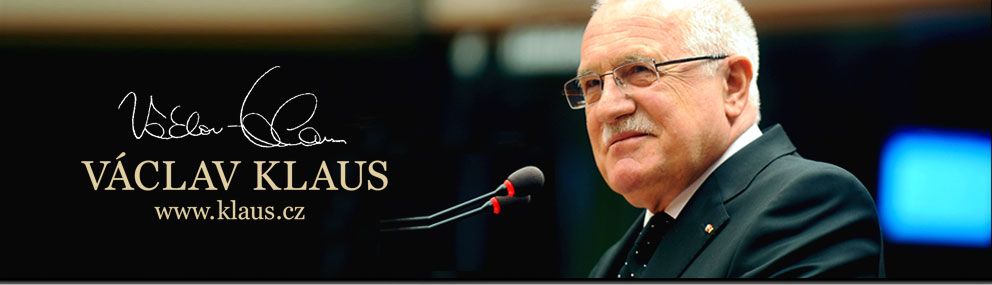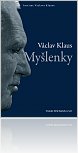Nejnovější
Nejčtenější
Hlavní strana » Deutsche Seiten » F.A.Z.-Gespräch mit dem…
F.A.Z.-Gespräch mit dem tschechischen Präsidenten
Deutsche Seiten, 28. 4. 2010
 FAZ: Herr Präsident, Sie halten am Donnerstag Ihre Europa-Rede an der Berliner Humboldt-Universität unter dem Titel: „Kritik der heutigen Form der europäischen Integration“. Wird das eine Kritik der reinen Vernunft sein?
FAZ: Herr Präsident, Sie halten am Donnerstag Ihre Europa-Rede an der Berliner Humboldt-Universität unter dem Titel: „Kritik der heutigen Form der europäischen Integration“. Wird das eine Kritik der reinen Vernunft sein?
VK: Hoffentlich. Im deutschen Kontext klingt das sehr schön. Die Kritik, die ich in dieser Rede vortrage, stellt keine Revolution in meinem Denken dar. Meine Position ist seit langem gut bekannt. Aber einiges werde ich etwas anders sagen, das ist ja auch die Herausforderung dieser Humboldt-Reden, die schon zehn Jahre Tradition haben. Die erste Rede von Joschka Fischer war ein deutliches Signal, ein Appell für die europäische Vereinheitlichung, für ein „immer engeres Europa“.
Sie werden den Anti-Fischer geben?
In gewissem Sinne ja. Für einige Eurokraten mag Fischers Rede eine kritische Rede gewesen sein, aber für mich war sie eine fast fanatische Aufforderung zu einem „immer engeren Europa“.
Was werden Ihre Hauptpunkte sein?
Meine Position ist die Negation dieser Idee des „immer engeren Europas“. Ich bin nicht dafür, ich bin hundert Prozent dagegen. Ich möchte kein Europa auf der Grundlage des Supranationalismus, ich möchte ein Europa auf der Grundlage der Zusammenarbeit der Regierungen und der europäischen Staaten, nicht irgendwo ein Europa und dann die Euro-Regionen. Das ist seit langem meine hauptsächliche Argumentation.
Neuerdings wird wegen einer Aschewolke die Forderung nach der Gestaltung eines einheitlichen europäischen Luftraum erhoben.
Das ist aber falsch. Ökonomisch betrachtet ist die Idee dieser Leute, dass die Externalitäten das Hauptproblem von Europa sind.
Was meinen Sie damit?
Was meinen die Ökonomen damit? Dass die grenzüberschreitenden Phänomene dominieren. Das ist die Hauptidee der europäischen Unifizierung. Und dazu sage ich nein. Die Externalitäten stellen nur einen kleinen Teil der europäischen Probleme dar. Wer sie für dominierend hält, will, dass alles von Brüssel aus gemacht wird: Luftraum, Rauchverbot und was nicht noch alles. Als Ökonom sage ich, dass die Externalitäten nur eine Ergänzung des Hauptinhaltes unseres Lebens sind.
Was sollte dann der Hauptinhalt der europäischen Integration sein?
Man muss scharf zwischen zwei Begriffen unterscheiden. Auf der einen Seite geht es um Integration. Auf der anderen geht es um Unifizierung, da spricht man von politischer Integration. Ich bin für die Marktintegration, für die ökonomische Integration, also für Liberalisierung, Öffnung und Beseitigung aller Barrieren. Solche Integration stärkt die Freiheit in Europa. Aber die politische Integration, die ich Unifizierung nenne, ist etwas ganz anderes, vor ihr habe ich Angst. Das sage ich schon lange. Angst, wirklich Angst. Denn was ist bedroht in Europa, heute und besonders nach dem Lissabon-Vertrag? Die Freiheit und die Prosperität.
Wie sehen Sie denn die Aussichten für eine weitere ökonomische Integration Europas, insbesondere nach der Griechenland-Krise. Welche Lehren sollte Europa daraus ziehen?
Mit dieser Frage übernehmen Sie schon die europäistische Ideologie. In der Krise muss man auf europäischer Ebene ökonomisch überhaupt nichts unternehmen. Die wirtschaftlichen Probleme von heute sind nicht europäische, es sind die Probleme von individuellen Unternehmen auf europäischem Boden und manchmal die Probleme der europäischen Staaten. Europa hat damit nichts zu tun, absolut nichts.
Die europäische Währungsunion ist gefährdet.
Die Währungsunion ist ein Teilprojekt des Europäismus, und kein erfolgreiches.
Würden Sie den Euro am liebsten abschaffen?
Warum abschaffen? Wir Tschechen sind nicht in der Euro-Zone und für mich ist es nicht relevant, ob die Leute in Portugal oder Spanien den Euro wollen oder nicht. Es ist deren politische Entscheidung. Abschaffen, das wäre eine diktatorische Haltung, die ich nicht habe. Natürlich kann man den Euro haben, aber die Kosten seiner Existenz sind enorm. Wir Menschen machen viele irrationale Sachen und dafür zahlen wir dann auch, das ist unsere freie Entscheidung. Die gemeinsame Währung in einem so großen Teil Europas war eine solche falsche Entscheidung, die sehr hohe Kosten verursacht.
Sie können Ihrem Land also nicht empfehlen, den Euro zu übernehmen?
Das habe ich schon tausendmal gesagt, das ist keine revolutionäre Neuigkeit.
Erwarten Sie nicht, dass die Tschechische Republik früher oder später doch der Euro-Zone beitreten wird?
Wahrscheinlich ja, sofern es dann die Euro-Zone noch gibt. Es gibt ja auch ökonomisch sinnvolle Währungsunionen. Die implizite Währungsunion zwischen Deutschland, Österreich und den Niederlanden seit 1980 etwa war ganz vernünftig und wirtschaftlich zweifellos vorteilhaft. Die Frage ist, ob auch Länder wie Portugal, Spanien oder Griechenland zu einem solchen optimalen Währungsgebiet gehören. In dieser Hinsicht würde ich sagen – und das wird manche Leute vielleicht überraschen -, dass die Tschechische Republik mehr oder weniger zum deutschen Wirtschaftsraum gehört. Wirtschaftlich atmen unsere Länder weitgehend harmonisch. Daher kann ich mir auch vorstellen, dass die Tschechische Republik zu einer solchen Währungsunion gehören könnte. Aber jetzt brauchen wir das nicht. Bisher hat es uns zweifellos geholfen, dass wir den Euro nicht hatten.
Die Länder, die der Euro-Zone angehören, sind also zu unterschiedlich, um eine gemeinsame Währung zu haben?
Jede Währungsunion braucht eine gewisse Homogenität. Die Unterschiede zwischen Irland und Griechenland oder zwischen Portugal und Finnland sind sehr groß. Deutschland stellt ja selbst auch eine Währungsunion dar, und es gab natürlich Probleme zwischen Ost- und Westdeutschland. Auch die Tschechoslowakei war eine Währungsunion, und die Slowaken dachten, dass es für sie nicht vorteilhaft wäre, sie zu behalten. Es ist eine empirische Frage, wann eine Währungsunion hilfreich ist und wann sie eine Bremse ist, eine sehr kostspielige Bremse. Das ist keine ideologische Frage.
Im Zuge der Griechenland-Krise ist die Forderung nach einer gemeinsamen Wirtschaftspolitik laut geworden; sie soll helfen, die Probleme des Euro zu lösen. Ist das ein Ausweg oder ein Irrweg?
Ich wollte weder die politische Union noch die gemeinsame Wirtschaftspolitik, deswegen wollte ich auch nicht die Europäische Währungsunion. Eine Währungsunion hat ökonomische und politische Voraussetzungen. In Deutschland waren vor zwanzig Jahren die ökonomischen Bedingungen nicht gegeben, aber sehr wohl die politischen, denn die Deutschen wollten wieder in einem Staat leben. In Europa gibt es ähnliche politische Voraussetzungen nicht. Die Debatte darüber, wie man mit Griechenland verfahren sollte, ist eine völlig andere Debatte als damals die deutsche darüber, wie man den Ostdeutschen helfen könnte. Es gab auch in Deutschland Kritik, der Eins-zu-Eins-Kurs beim Umtausch der DDR-Mark war ökonomisch ein Fehler, aber die politische Ambition und die klare Solidarität waren vorhanden. In Europa gibt es die nicht.
Reicht nicht wenigstens die erklärte Solidarität der Politiker gegenüber Griechenland?
So klar ist das mit deren Solidarität nicht. In Deutschland unterscheiden sich schon die Positionen der Kanzlerin und des Finanzministers, wenn ich das von außen beurteilen kann. Solidarität gibt es schon, aber es ist nicht eine Solidarität wie innerhalb Deutschlands. Es gibt eine politische Solidarität, aber nicht die menschliche Solidarität. In Deutschland konnte die Währungsunion realisiert werden, weil es menschliche Solidarität gab. Es ist übrigens interessant, dass bei Griechenland auch der Internationale Währungsfonds in Spiel gebracht wird. Der darf seiner Bestimmung gemäß nur bei Zahlungsbilanzdefiziten und unerwarteten Kursschwankungen intervenieren. Beides ist in Griechenland nicht der Fall. Theoretisch dürfte der IWF nur der Euro-Zone als ganzer helfen, denn Zahlungsbilanzdefizite lassen sich für ein einzelnes Land der Währungsunion nicht definieren und Kursschwankungen gibt es seit der Abschaffung der Drachme auch nicht. Ich bin kein Jurist und deshalb auch kein Purist, meine Antwort wird immer eine ökonomische sein, aber rein rechtlich betrachtet darf der IWF hier nicht eingreifen.
Ein Argument lautet, wenn Griechenland nicht den Euro hätte, wäre der Staatsbankrott schon eingetreten.
Dem kann ich überhaupt nicht zustimmen. Griechenland brauchte eine Abwertung von etwa vierzig Prozent, aber die Drachme gibt es leider nicht mehr. Die Alternative ist die Senkung aller Löhne und Gehälter um vierzig Prozent, aber das ist nicht so einfach in einer demokratischen Gesellschaft. Die wirkliche Ursache der Tragödie ist nicht die rationale oder irrationale Wirtschaftspolitik in Griechenland, es ist der Euro, der diese Tragödie bewirkt. Ohne ihn könnten die griechischen Politiker und Banker die Krise mit den seit Jahrhunderten geläufigen Mitteln lösen. Aber Griechenland darf jetzt nicht mehr abwerten, das ist die Neuigkeit. Dann gibt es nur noch eine Lösung, nämlich den Transfer von Steuergeldern aus anderen Ländern der Währungsunion.
Da dürfte es Widerstand geben.
Es muss Widerstand geben. Warum sollen die deutschen Steuerzahler Griechenland subventionieren? Das ist eine ganz legitime Frage.
Ist die Währungsunion also zum Scheitern verurteilt?
Das habe ich nicht gesagt. Wir müssen unterscheiden. Lautet die Frage, ob der Euro seine Versprechen gehalten hat, dann ist meine Antwort: nein. Bezüglich des Wirtschaftswachstums und der ökonomischen Stabilität ist die Euro-Zone schon seit langem gescheitert. Wenn wir aber über das formale Scheitern der Währungsunion sprechen, dann muss man berücksichtigen, wie viel politisch bereits in dieses Projekt investiert wurde. Die Politiker werden das Scheitern des Euro nicht zulassen, aber die Kosten dafür werden sehr hoch sein.
Glauben Sie, dass die weltweite Finanzkrise integrative Tendenzen in Europa stärkt?
Nein, die Krise selbst befördert nicht solche Tendenzen, aber die Krise wird politisch als Argument für noch mehr Europäisierung benutzt. Ich bin hundertprozentig gegen eine europaweite Finanzmarktregulierung, das ist auch die unzweideutige Position der tschechischen Nationalbank und des Finanzministeriums. Ich befürchte eine weitere Unifizierung, weil sie die Probleme nur noch größer macht.
Wie denken Sie über eine verstärkte europäische Zusammenarbeit in der Außen- und Sicherheitspolitik?
Ich glaube nicht, dass wir das brauchen. Ich sehe keine dramatische oder radikale Unsicherheit in Europa. Für die bestehenden Herde der Unsicherheit wie Iran oder Nordkorea reichen die bestehenden Institutionen aus. Man kann die Außenpolitik in der Union auch ohne institutionelle Änderungen koordinieren, ohne europäische Außenminister und so weiter. Die Zusammenarbeit der Regierungen reicht auch auf diesem Gebiet völlig aus.
Auf der einen Seite werden europäische Identität, Supranationalität und Multikulturalismus als Mittel zur Überwindung des Nationalismus in Europa angesehen, auf der anderen Seite sprechen sich die Bürger in Wahlen und Plebisziten dagegen aus. Was bedeutet Ihnen die europäische Identität?
Zweifellos gibt es auch eine europäische Identität. Als ich in Amerika einmal beim Schifahren gefragt wurde, woher ich käme, sagte ich: aus Europa. Ich war mir sicher, dass der junge Mann von der Antwort „Tschechische Republik“ überfordert gewesen wäre. Europa ist also eine meiner Identitäten. Die Frage ist, wie stark sie ist. Ich halte sie nicht für sehr stark. Sie wird von den Eurokraten in Brüssel künstlich gefördert, authentisch ist das nicht. Ich bin ein Prager, ein Tscheche, auch ein Mitteleuropäer, diese drei Identitäten sind stärker als die europäische. Den Multikulturalismus halte ich für einen tragischen Fehler, der uns in große Schwierigkeiten bringt. Die Reaktionen dagegen sind nicht meine Reaktionen, ich bin mit ihnen nicht einverstanden. Diese Reaktionen sind von den EU-Eliten auch nicht beabsichtigt, aber sie werden von ihnen herbeigeführt. Es ist der Multikulturalismus, der Leute wie Geert Wilders macht. Ohne die falsche Ideologie des Multikulturalismus würden solche Leute in Europa heute keine Rolle spielen.
In der Tschechischen Republik gibt es Ende Mai Parlamentswahlen. Wird es danach eine stabile Regierung geben?
Das weiß ich nicht. Zu einer parlamentarischen Patt-Stellung von 100 zu 100 Mandaten wie im 2006 wird es wahrscheinlich nicht mehr kommen. Aber wir wissen nicht, ob die Regierung eine seriöse und stabile Mehrheit haben wird. Klar ist, dass die beiden Großparteien an Unterstützung verloren haben, sie werden gemeinsam weniger Mandate erhalten. Das öffnet den Raum für neue, völlig unbekannte Parteien ohne Programm und ohne Persönlichkeiten, und das könnte gefährlich werden.
Herr Präsident, Sie sind mitten in der zweiten Amtszeit, ein dritte gibt es nicht. Den Ehrenvorsitz Ihrer Partei, der ODS, haben sie niedergelegt. Fühlen Sie sich politisch vereinsamt in Ihrem Land?
Ich habe völlig andere Positionen als die Politiker, das erschwert mir manchmal mein Amt als Präsident. Aber ich bin keineswegs isoliert, schon gar nicht bei den Menschen. Das belegen die Meinungsumfragen sehr klar.
Das Gespräch mit tschechischen Präsidenten führten Bertold Kohler und Karl-Peter Schwarz, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 28. April 2010
- hlavní stránka
- životopis
- tisková sdělení
- fotogalerie
- Články a eseje
- Ekonomické texty
- Projevy a vystoupení
- Rozhovory
- Dokumenty
- Co Klaus neřekl
- Excerpta z četby
- Jinýma očima
- Komentáře IVK
- zajímavé odkazy
- English Pages
- Deutsche Seiten
- Pagine Italiane
- Pages Françaises
- Русский Сайт
- Polskie Strony
- kalendář
- knihy
- RSS
Copyright © 2010, Václav Klaus. Všechna práva vyhrazena. Bez předchozího písemného souhlasu není dovoleno další publikování, distribuce nebo tisk materiálů zveřejněných na tomto serveru.